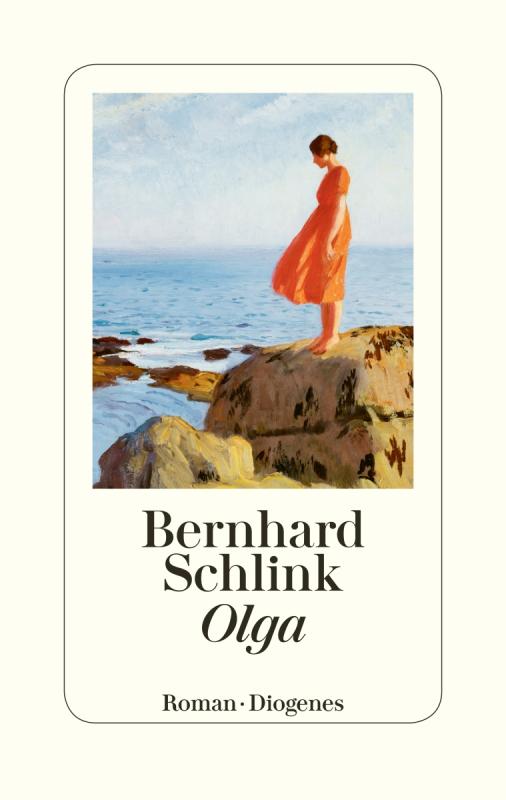Bernhard Schlink kann es mir nicht recht machen. Oder ist es Olga? Jedenfalls hinterlässt die Lektüre von „Olga“ bei mir den faden Geschmack eines zu lange offenen Weines: Auch wenn die Idee „Südhang“ ist (um im Bild zu bleiben), die Reben erste Wahl und der Winzer ein Könner, ist am Ende das Produkt ein in drei ungleiche Teile zerfallendes Stückwerk.
Olga ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren, wächst als Waise ungeliebt von der Großmutter bei ebendieser im schlesischen Nirgendwo auf, verbringt die Jugend mit Herbert Schröder, dem Sohn des neureichen Gutsherrn, wird seine Geliebte und heimliche Verlobte, kämpft sich gegen die widrige Rückständigkeit der gestrigen Männerwelt durch höhere Schule, Studium und Schuldienst, verliert Herbert als Arktisforscher im ewigen Eis, um ertaubt als Näherin die Nachkriegszeit am Rhein zu erleben. Hier inspiriert sie den jungen Ferdinand mit ihren Erzählungen vor allem ihres geliebten Herberts in ähnlicher Mentorschaft wie den Jungen Eik in ihrer Lehrerstelle bei Tilsit. Sie stirbt mit einem Knalleffekt, den Schlink uns am Ende des Romans beschert.
Wem diese Zusammenfassung zu nüchtern erscheint, der lese den ersten Teil des Romans: Der Tonfall ist ähnlich distanziert, verknappend, deskriptiv. Ich hatte das Gefühl, das Exposé zu einem Roman zu lesen, nicht aber einen Roman. Schlink lässt uns nicht nah an die Figuren heran, weder an Olga noch an Herbert Schröder noch an dessen eifersüchtige Schwester. „Die Angst, schwanger zu werden, können sich Menschen heute nicht vorstellen“, lese ich auf Seite 51 und kann es mir auch nicht vorstellen, weil Schlink uns diese Angst nur bezeichnet, aber nicht vorführt. Das ist schade, denn Olgas Leben ist außergewöhnlich, ich hätte gern mit ihr gefühlt. Übrigens ist ihr Herbert auch außergewöhnlich, denn es handelt sich um den tragischen deutschen Arktisforscher Herbert Schröder-Stranz, dessen Leben einen eigenen Roman wert wäre und dessen Schicksal im ewigen Eis vielleicht sogar am Anfang von Schlinks Idee zu „Olga“ gestanden haben mag. Aber die Geschichte eines gescheiterten Arktisforschers im Spiegel der zurückbleibenden Geliebten zu schreiben, mag zwar pfiffig sein, bleibt aber eine Arktisforschergeschichte ohne Arktis …
Der zweite Teil des Romans wird von Ferdinand bestritten, dem Olga eine Mentorin gewesen ist, indem sie ihm als Näherin in der Familie mit Literatur und den Geschichten aus ihrer Zeit und ihrem Leben eine Richtung gegeben hat. Hier wird Olga zu „Fräulein Rinke“, und jetzt erst wird klar, dass der erste Teil Olgas Leben referiert hat, sozusagen wie Ferdinand es sich aus den Erzählungen Fräulein Rinkes zusammengebastelt hat. Ferdinand erzählt nun den letzten Teil von Olgas Leben, den er miterlebt hat. Ferdinand selbst ist zwar der beste Olga-Kenner seit Herberts Tod, aber sein ganzes Leben passt auf die Seiten 168 bis 170: vom Ende des Studiums bis zur Pensionierung. Irgendwie … fad.
Im dritten Teil spürt Ferdinand Olgas Leben nach und hebt findig den Schatz ihrer Briefe an den verschollenen Herbert. Diese Briefe bilden den dritten Teil des Buches und schließen die Lücke zwischen der jungen Olga und dem alten Fräulein Rinke. Diese Briefe klingen in dem emotionalen Ton, dem liebevollen Detail und der persönlichen Nähe des Romans, wie ich sie zuvor so vermisst habe. Nun aber werfen sie die Frage auf, wie die drei Olgas eigentlich zusammengehören? Passen sie eigentlich? Will Schlink uns sagen, dass unsere Persönlichkeiten so facettenreich sein können, dass wir einander nie ganz kennen können? Wenn ja, dann habe ich das schon deutlich raffinierter gelesen, wenn nein, dann ist die ganze Figur so eine Art Unfall.
Schlink will mit dem Roman, der mehr als ein Jahrhundert überspannt und in seinen Figuren von Bismarck über Wilhelm II., die Nazis, Adenauer bis hin zu Rudi Dutschke berührt, offenbar aber auch große deutsche Fragen klären, womöglich sogar großdeutsche. Olga schreibt über ihr Leben, sie sei nicht Herberts Witwe, nicht die Witwe eines möglichen Heiratsaspiranten unter ihren Kollegen in Tilsit, sondern „Bernhard Schlink kann es mir nicht recht machen. Oder ist es Olga? Jedenfalls hinterlässt die Lektüre von „Olga“ bei mir den faden Geschmack eines zu lange offenen Weines: Auch wenn die Idee „Südhang“ ist (um im Bild zu bleiben), die Reben erste Wahl und der Winzer ein Könner, ist am Ende das Produkt ein in drei ungleiche Teile zerfallendes Stückwerk.
Olga ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren, wächst als Waise ungeliebt von der Großmutter bei ebendieser im schlesischen Nirgendwo auf, verbringt die Jugend mit Herbert Schröder, dem Sohn des neureichen Gutsherrn, wird seine Geliebte und heimliche Verlobte, kämpft sich gegen die widrige Rückständigkeit der gestrigen Männerwelt durch höhere Schule, Studium und Schuldienst, verliert Herbert als Arktisforscher im ewigen Eis, um ertaubt als Näherin die Nachkriegszeit am Rhein zu erleben. Hier inspiriert sie den jungen Ferdinand mit ihren Erzählungen vor allem ihres geliebten Herberts in ähnlicher Mentorschaft wie den Jungen Eik in ihrer Lehrerstelle bei Tilsit. Sie stirbt mit einem Knalleffekt, den Schlink uns am Ende des Romans beschert.
Wem diese Zusammenfassung zu nüchtern erscheint, der lese den ersten Teil des Romans: Der Tonfall ist ähnlich distanziert, verknappend, deskriptiv. Ich hatte das Gefühl, das Exposé zu einem Roman zu lesen, nicht aber einen Roman. Schlink lässt uns nicht nah an die Figuren heran, weder an Olga noch an Herbert Schröder noch an dessen eifersüchtige Schwester. „Die Angst, schwanger zu werden, können sich Menschen heute nicht vorstellen“, lese ich auf Seite 51 und kann es mir auch nicht vorstellen, weil Schlink uns diese Angst nur bezeichnet, aber nicht vorführt. Das ist schade, denn Olgas Leben ist außergewöhnlich, ich hätte gern mit ihr gefühlt. Übrigens ist ihr Herbert auch außergewöhnlich, denn es handelt sich um den tragischen deutschen Arktisforscher Herbert Schröder-Stranz, dessen Leben einen eigenen Roman wert wäre und dessen Schicksal im ewigen Eis vielleicht sogar am Anfang von Schlinks Idee zu „Olga“ gestanden haben mag. Aber die Geschichte eines gescheiterten Arktisforschers im Spiegel der zurückbleibenden Geliebten zu schreiben, mag zwar pfiffig sein, bleibt aber eine Arktisforschergeschichte ohne Arktis …
Der zweite Teil des Romans wird von Ferdinand bestritten, dem Olga eine Mentorin gewesen ist, indem sie ihm als Näherin in der Familie mit Literatur und den Geschichten aus ihrer Zeit und ihrem Leben eine Richtung gegeben hat. Hier wird Olga zu „Fräulein Rinke“, und jetzt erst wird klar, dass der erste Teil Olgas Leben referiert hat, sozusagen wie Ferdinand es sich aus den Erzählungen Fräulein Rinkes zusammengebastelt hat. Ferdinand erzählt nun den letzten Teil von Olgas Leben, den er miterlebt hat. Ferdinand selbst ist zwar der beste Olga-Kenner seit Herberts Tod, aber sein ganzes Leben passt auf die Seiten 168 bis 170: vom Ende des Studiums bis zur Pensionierung. Irgendwie … fad.
Im dritten Teil spürt Ferdinand Olgas Leben nach und hebt findig den Schatz ihrer Briefe an den verschollenen Herbert. Diese Briefe bilden den dritten Teil des Buches und schließen die Lücke zwischen der jungen Olga und dem alten Fräulein Rinke. Diese Briefe klingen in dem emotionalen Ton, dem liebevollen Detail und der persönlichen Nähe des Romans, wie ich sie zuvor so vermisst habe. Nun aber werfen sie die Frage auf, wie die drei Olgas eigentlich zusammengehören? Passen sie eigentlich? Will Schlink uns sagen, dass unsere Persönlichkeiten so facettenreich sein können, dass wir einander nie ganz kennen können? Wenn ja, dann habe ich das schon deutlich raffinierter gelesen, wenn nein, dann ist die ganze Figur so eine Art Unfall.
Schlink will mit dem Roman, der mehr als ein Jahrhundert überspannt und in seinen Figuren von Bismarck über Wilhelm II., die Nazis, Adenauer bis hin zu Rudi Dutschke berührt, offenbar aber auch große deutsche Fragen klären, womöglich sogar großdeutsche. Olga schreibt über ihr Leben, sie sei nicht Herberts Witwe, nicht die Witwe eines möglichen Heiratsaspiranten unter ihren Kollegen in Tilsit, sondern „die Witwe einer Generation“. (S. 289). Das ist dann doch ein wenig zu groß - und zu Großes hat Olga an den Deutschen, den deutschen Männern immer gehasst. Zu recht.
Zu große Ideen in einem zu kleinen Roman in drei ungleichen Teilen - das gefällt mir nicht. “. (S. 289). Das ist dann doch ein wenig zu groß - und zu Großes hat Olga an den Deutschen, den deutschen Männern immer gehasst. Zu recht.
Zu große Ideen in einem zu kleinen Roman in drei ungleichen Teilen - das gefällt mir nicht.