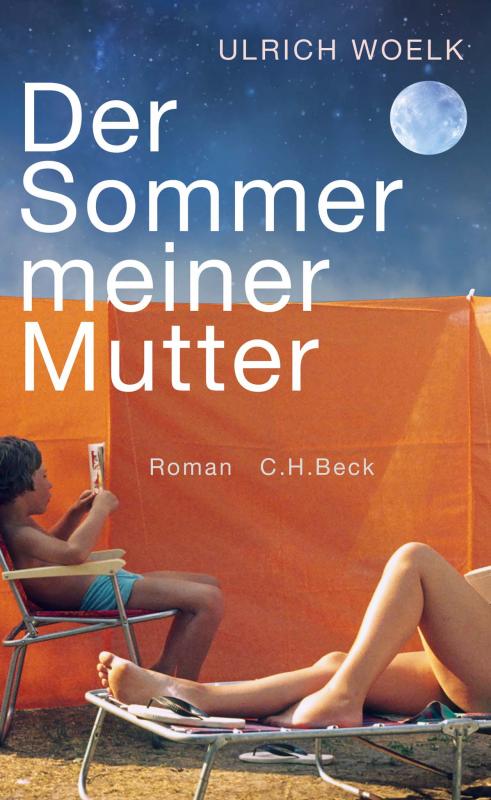Ulrich Woelk – Der Sommer meiner Mutter
1968 hat die Welt verändert, für den 11-jährigen Tobi kommt das größte Ereignis seines Lebens jedoch erst im darauffolgenden Jahr mit der Ankündigung der Mondlandung. Doch auch in seinem unmittelbaren ...
1968 hat die Welt verändert, für den 11-jährigen Tobi kommt das größte Ereignis seines Lebens jedoch erst im darauffolgenden Jahr mit der Ankündigung der Mondlandung. Doch auch in seinem unmittelbaren Leben wird am Ende des Sommers nichts mehr so sein wie zuvor. Mit dem Einzug der Leinhards ins Nachbarhaus wird so ziemlich alles in Frage gestellt, was bis dato feste Größen in seinem Leben waren: die Rolle seiner Mutter als Hausfrau, das Politische hält Einzug in die Kölner Idylle der Kleinfamilie und aus dem Jungen wird ein Jugendlicher, der mit der Nachbarstochter seine ersten sexuellen Erfahrungen sammelt. Tobi erlebt seinen persönlichen „Summer of Love“, jedoch auch die Erwachsenen hinterfragen nochmals den Lebensentwurf, für den sie sich entschieden haben.
Ulrich Woelk ist mir namentlich als Autor bekannt, bislang hatte ich jedoch noch keinen seiner Romane gelesen. Mit der Nominierung auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2019 ist er jedoch in meinen Fokus gerückt und hat mich neugierig auf seine anderen Werke gemacht. Er ist ein routinierter Erzähler, der ohne Ecken und Kanten durch die Handlung gleitet und einem so das Eintauchen in seine Geschichte leicht macht.
Oberflächlich betrachtet ist „Der Sommer meiner Mutter“ eine Coming-of-Age Geschichte, die er in einer historisch interessanten Zeit angesiedelt hat. Schaut man jedoch genauer hin, birgt der Roman alle großen Themen der BRD in sich, die Ende der 1960er/Anfang der 1970er den öffentlichen und privaten Diskurs bestimmten. Durch die Erzählperspektive kann er sich davor bewahren, zu werten und den Erzähler Position beziehen zu lassen, denn der 11-jähirge Tobi kann nur wahrnehmen, aber nicht einordnen oder gar verstehen, was er sieht.
Was so idyllisch beginnt, läuft dann doch recht stringent auf die unvermeidliche Katastrophe zu. Der Ausgang ist bekannt, denn damit leitet Woelk den Roman ein:
„Im Sommer 1969, ein paar Woche nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben.“
Die Emanzipation hat 1968 bereits Wellen geschlagen, in den Vorstadthäusern bei den Hausfrauen und Müttern war sie jedoch nicht angekommen. Nun ist es so weit und die beiden Nachbarinnen wagen sich, eine Meinung und einen Beruf zu haben, sich aus den selbstgewählten Fesseln zu befreien und ihren Instinkten zu folgen. Währenddessen tragen die Männer den Kampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus aus, ebenso wie zwischen Geistes- und Ingenieurswissenschaften. Was nutzt schon all das Denken, wenn man keine Deckenlampe befestigen kann?
Tobias beginnt sich zu lösen, seine Eltern und alle anderen Erwachsenen plötzlich mit anderen Augen, als eigenständige Wesen über ihre unmittelbare Funktion für ihn hinaus zu sehen. Mal neugierig, mal verstört blickt er auf diejenigen, die eigentlich souverän im Leben stehen sollten, gerade aber durch heftige Erdbeben erschüttert werden und ins Wanken geraten. Ulrich Woelk findet das Große im Kleinen und konnte mich vom ersten Kapitel an für die Geschichte gewinnen. Die gesellschaftliche Relevanz ist allemal gegeben, ob es für die Shortlist des Buchpreises reichen wird, wage ich momentan – jedoch in Unkenntnis der meisten Nominierten – jedoch zu zweifeln.