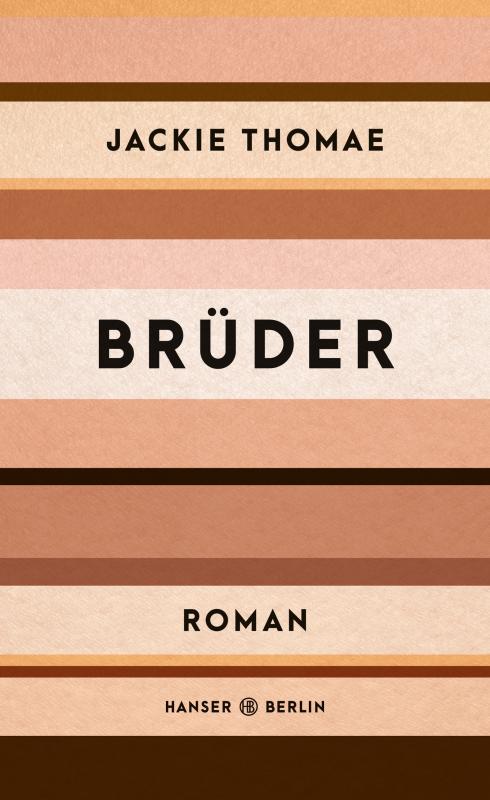Jackie Thomaes Roman „Brüder“ ist auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2019, und ich frage mich warum. Die Rezension der Süddeutschen Zeitung begrüßt sowohl den „beiläufigen“ Stil als auch die Tatsache, dass ‚Hautfarbe‘ im Roman zwar Hauptthema sei, aber nur indirekt angesprochen werde.
Beides sind für mich die Gründe, weshalb mir der Roman nicht preiswürdig erscheint. Thomae erzählt die Lebensgeschichten der beiden titelgebenden „Brüder“, die freilich voneinander nichts wissen. Beide 1970 vom selben Vater „beiläufig“ gezeugt, wachsen sie in der DDR auf, verfolgen unterschiedliche Lebenswege und finden zu sich – oder eben nicht. Mick und Gabriel wachsen vaterlos auf, Gabriel sogar elternlos, und kämpfen sich durch ihr Leben wie ich durch die Seiten. Mick trudelt durch die Möglichkeiten, Chancen und das Berliner Nachtleben, um nach dem persönlichen und beruflichen Scheitern um 2000 einen Neuanfang machen zu können. Gabriel hingegen steigt als Architekt linear auf, strauchelt erst spät durch einen Fehltritt und richtet einen Scherbenhaufen an, den er als sein Leben betrachten muss.
Die Lebenswege der Brüder werden völlig getrennt voneinander erzählt. Sie sind verbunden nur durch denselben Vater, formal auch im Roman, denn Idris‘ Intermezzo bildet das Scharnier beider Romanteile.
Der beiläufige Ton von Micks Geschichte hat etwas Chronikales, Unbeteiligtes, das eine enorme Distanz zu Figuren und Geschehen erzeugt. Plötzlich wechselt der auktoriale Erzähler aber die Figur und guckt einem anderen Menschen in den Kopf – ein notwendiger Perspektivwechsel in eines anderen Menschen inneren Monolog, weil die Erzählform es sonst nicht erlaubt hätte, aus Handlungen und Äußerungen Micks ausreichend Stoffliches zu ziehen – und eine verwundbare Autorinentscheidung, die es sich damit zu leicht macht.
Als ich endlich mit Mick warm geworden war – da hatten wir ihn auch schon zwanzig und mehr Jahre begleitet –, stolpern wir über Idris‘ Intermezzo in Gabriels Geschichte. Hier wechselt die Erzählposition zu zwei Ich-Erzählern, nämlich Gabriel und seine Frau Fleur. Nicht nur deshalb wirkt der zweite Teil des Romans wie eine eigenständige Geschichte. Hier werden zwar Gedanken, Handlungen und Äußerungen der Figuren besser motiviert, aber das über die Buchseiten Hinausweisende fehlt mir hier auch.
Denn die indirekte Form, in der die Hautfarbe der beiden Brüder immer mal wieder, aber nie leitend in die Geschichte Eingang findet, erschwert es sehr, das behaupteten Hauptthema auch als solches zu erkennen. Ich für meinen Teil halte beide Geschichten für genauso erzählbar, wenn die Brüder keine andersgeartete Hautschattierung aufweisen würden. Die Lebensläufe der Brüder sind zudem so verschieden, dass sie sich nicht vergleichen lassen, nicht einmal als Gegenentwürfe. Wenn das aber so auf mich wirkt, fehlt das Tertium comparationis, etwa die Hautfarbe. Dann erscheint mir erzählerisch schon eher bedeutsam, wie zwei intelligente junge Männer mit ihrer DDR-Herkunft in die Welt ziehen.
Kurzum: Mit Bedeutung schwanger erschien mir der Roman während der Lektüre nicht, wohl aber zu lang und zu „beiläufig“. Das macht ihn noch lange nicht zu einem schlechten. Aber preiswürdig?