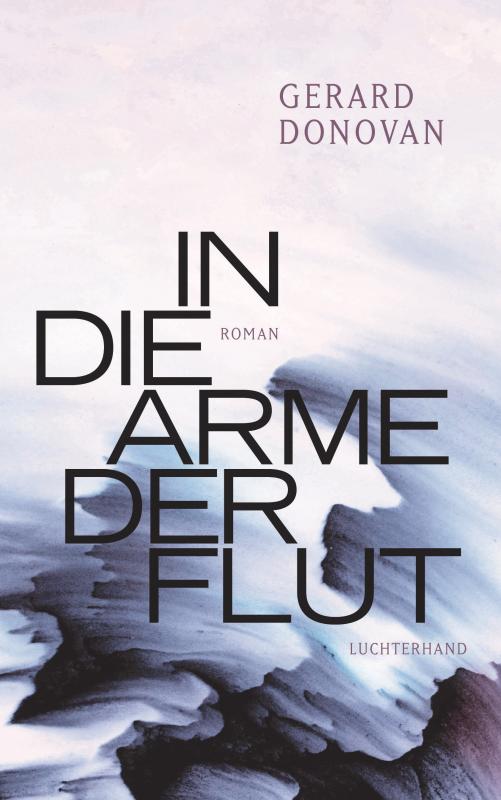…bist du vollkommen glücklich und deine Seele lebt irgendwo weiter. Ich habe keine Angst zu sterben. Vollkommener Frieden nach dem Tod, jemand anderes zu werden ist die beste Hoffnung, die ich habe.“ Mit diesem Zitat von Kurt Cobain könnte man den Punkt beschreiben, an dem sich auch die Hauptfigur in Gerard Donovans „In die Arme der Flut“ befindet.
Luke Roy lebt in Ross Point, einem von Gott und der Welt verlassenen Kaff in Maine, arbeitet dort in einer Fabrik, tagaus, tagein die gleiche Monotonie. Sein Denken kreist seit frühester Jugend um den Tod, es ist ein diffuses Sehnen nach dem Ende. Versucht hat er es bereits, allerdings nicht in letzter Konsequenz durchgeführt. Aber jetzt ist es soweit. Schnell soll es gehen, und im wahrsten Sinn des Wortes todsicher sein. Der richtige Zeitpunkt scheint gekommen. Ein Sprung von der Brücke in den Moss River, 35 Meter in die Tiefe, der Körper zerschmettert, von der Strömung ins Meer gezogen. Oder doch nicht? Er zaudert, er zögert, entscheidet sich dagegen, dreht um und bemerkt im Weggehen ein Kind, das aus einem gekenterten Boot gefallen ist und auf einen Strudel zutreibt. Ohne Zögern wagt er den Sprung, bekommt es zu fassen und rettet es. Es scheint, als ob Paul, so der Name des Jungen, ein Seelenverwandter Lukes wäre, da er keinerlei Anstrengungen unternommen hat, den Fluten zu entkommen.
Passanten haben die Aktion beobachtet, stellen ihre Fotos davon ins Netz, die Anzahl der Klicks explodiert. Luke steht plötzlich im Zentrum des Interesses, wird zur Berühmtheit, erhält eine Tapferkeitsmedaille. Politiker lassen sich mit ihm ablichten, instrumentalisieren ihn für ihren Wahlkampf. Doch Ruhm ist vergänglich. Alles ändert sich, als ein Video auftaucht, das das Ereignis in einem anderen Licht erscheinen lässt, und plötzlich schlägt ihm blanker Hass entgegen. Diejenigen, die ihm gestern noch auf die Schulter geklopft haben, wenden sich von ihm ab. Steine fliegen, das Boot, auf dem er lebt, geht in Flammen auf. Doch dann wird der Zeitung ein weiterer Film zugespielt, der Lukes Version bestätigt, und schon ist der Außenseiter wieder der strahlende Held, der er nie sein wollte. Aber für die Brandstiftung, den Verlust seines Bootes, seines Heims, übernimmt niemand Verantwortung.
Wie bereits in dem erfolgreichen „Winter in Maine“ steht auch in dem diesem Roman ein Mensch im Mittelpunkt, dessen Leben von einem Gefühl der Isolation durchdrungen ist. Luke fühlt sich fremd unter Menschen, ist einsam und hat im Laufe seines Lebens eine ungesunde Faszination für den Tod entwickelt. Leidet er an Depressionen? Will er sterben? Eindeutig ist beides nicht, es bleibt in der Schwebe.
Aber der Roman ist mehr als das Psychogram eines Außenseiters, er ist gleichzeitig eine Abrechnung mit unserer medialen Welt, die sensationsgierig jede halbwegs interessante Information durch den Wolf dreht, jedoch das, was dieses Vorgehen mit den Menschen macht, völlig ignoriert. Hauptsache, die Anzahl der Klicks stimmt.