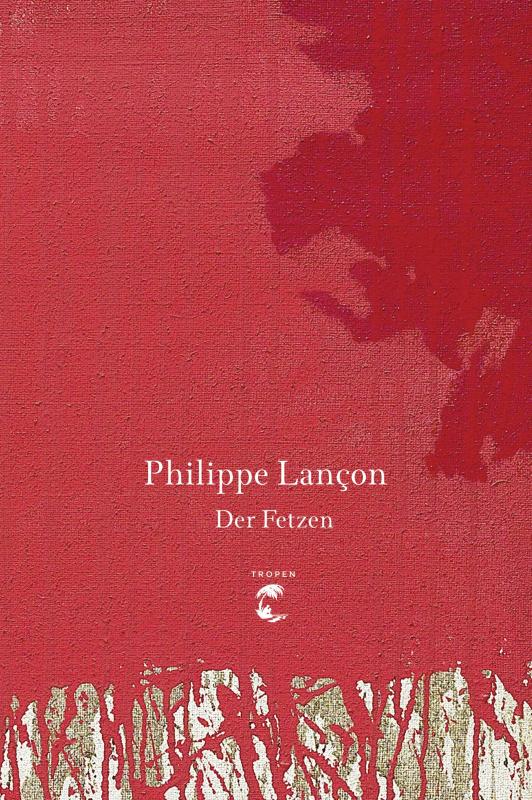„Vier in dem einen, eins im anderen Krankenhaus: Das sind die Zimmer, in denen ich vom 8. Januar 2015 bis zum 17. Oktober 2015 rund um die Uhr geblieben bin, was insgesamt, wenn ich richtig rechne, 282 Tage ergibt. Gefangene zählen und oft auch Kranke, weil sie am liebsten fliehen und verschwinden würden. Ich war weder gefangen noch krank: Ich war ein Opfer, ein Verletzter (...)“
Philippe Lançon, Reporter und Kritiker, der am Morgen des 7. Januar 2015 an der Redaktionssitzung von Charlie Hebdo teilnahm, der Wochenzeitung, die in den letzten Zügen lag und deren unabwendbarer Tod nur noch eine Frage von wenigen Ausgaben war. Der Tod sollte kommen, aber nicht für die satirische Wochenzeitung, sondern für ihre Macher, in Form der Brüder Kouachi, die bewaffnet in die Redaktionsräume eindrangen und um sich schossen. Elf Tote und zahlreiche Verletze ist die Bilanz, die global Schlagzeilen machte. Eines der Opfer war Philippe Lançon, der erst begreifen musste, das er Teil eines großen Ereignisses wurde und sein Leben von nun an in eine Zeit vor dem 7. Januar und eine Zeit nach dem 7. Januar 2015 getrennt werden würde.
„Der Fetzen“, in Frankreich mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Spezialpreis des renommierten Prix Renaudot, der eigentlich Belletristik ehrt, ist eine Biographie der besonderen Art. Sie beschränkt sich auf wenige Monate, die Zeit von dem Anschlag auf Charlie Hebdo und sie endet auch mit einem Anschlag, dem auf das Bataclan am 13. November desselben Jahres. Es ist die Zeit für Philippe Lançon zwischen Tod und Rückkehr ins Leben, die Zeit von 17 Operationen und einem alles andere als optimal verlaufenden Heilungsprozess, den er minutiös mit dem Leser teilt. Letztlich ist es der Versuch etwas zu verstehen und zu verarbeiten, was weder verstehbar noch vergessbar ist. Es ist die persönliche Seite eines globalen medialen Großereignisses, das die Aspekte darstellt, die dem fernen Beobachter üblicherweise vorenthalten bleiben.
Mich hat Philippe Lançons Bericht schwer beeindruckt. Zum einen die Offenheit, mit der er die wiederholten Niederschläge im Heilungsprozess schildert, die Widrigkeiten während des Krankenhausaufenthaltes – es sind die Dinge, über die wir eigentlich nicht sprechen, die in unserer von ansprechender Optik dominierten Welt keinen Platz haben. Es sind aber vor allem auch seine persönlichen Beziehungen, die nach dem Attentat nicht mehr dieselben sind. Nicht nur ihn hat das Ereignis verändert, es wirkt auch sekundär auf sein Umfeld und er muss erkennen, dass nicht jeder mit der neuen Situation umgehen kann.
Der Autor ist ein außerordentlich reflektierter Mensch, was man dem Buch auf jeder Seite anmerkt. Er versucht nicht, einen tieferen, gar religiösen Sinn darin zu erkennen, dass gerade er Opfer wurde. Ebenso spielen seine Emotionen in Bezug auf die Attentäter keinerlei Rolle. Er lebt im Hier und Jetzt, aber er kann nicht mehr einfach irgendetwas lesen, es sind Proust und Kafka, die ihn ansprechen. Wie Prousts Protagonist wird auch er von Erinnerungsfetzen aus seiner Vergangenheit geplagt und kann bisweilen nur mit einer distanzierenden Ironie die kafkaesken Gegebenheiten ertragen. Es ist eine subjektive Verarbeitung, die keinen größeren Zusammenhang schafft, die Banalitäten – steht sein Fahrrad immer noch vor der Redaktion? Wo ist sein Stoffbeutel? – in den Fokus rückt und einem den Autor dadurch nah bringt.
Philippe Lançon ist Charlie Hebdo – mehr als alle, die sich den Slogan zu eigen gemacht haben. Aber er will nicht die Stimme oder das Gesicht sein, dafür ist er zu bescheiden. Er ist ein Überlebender, der das Überleben erst wieder zu schätzen lernen musste und dem, auch wenn man ihm über lange Zeit die Stimme raubte, doch nie die Worte ausgingen, was ein Glücksfall ist.