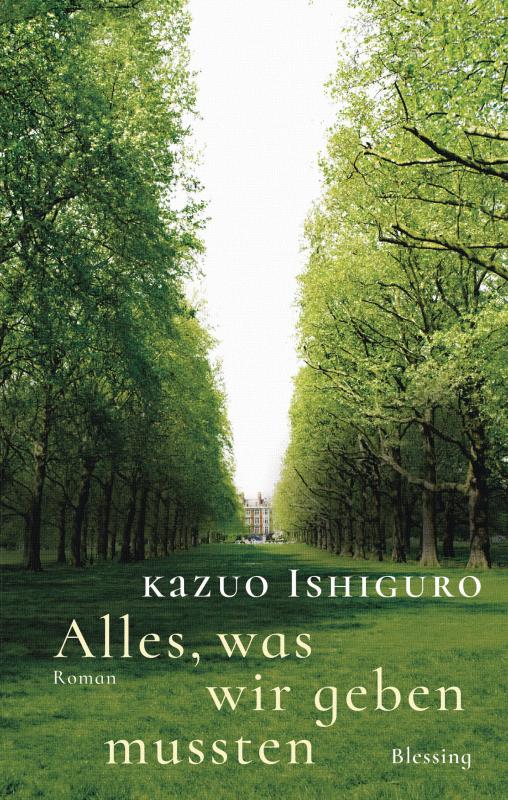„Alles, was wir geben mussten“ von Kazuo Ishiguro ist ein Roman, der mich bewegt und nachdenklich gestimmt hat. Ein Roman, über den ich reden und diskutieren, den ich weiterempfehlen will! Doch das ist gar nicht so leicht, ohne den Dreh- und Angelpunkt der Geschichte zu verraten, der für all das unbeschreibliche Entsetzen verantwortlich ist, das einen während des Lesens beschleicht.
Kurzum: „Alles, was wir geben mussten“ ist eine Dystopie. Keine der leichten, unterhaltsamen Sorte, sondern eine anspruchsvolle, fordernde, die ihrem Leser nicht einfach ein paar vergnügsame Lesestunden beschweren will. Kazuo Ishiguro erzählt eine Geschichte, die sich mit (scheinbar) dystopischen Elementen beschäftigt, allerdings in der Vergangenheit angesiedelt ist und in den 70er Jahren beginnt. Die Handlung zieht sich durch die Jahrzehnte bis in die Gegenwart, was für ein ganz ungutes Gefühl sorgt: Könnte das, was Kazuo Ishiguro beschreibt, in unserer Zeit, unserer Welt tatsächlich geschehen?
Erzählt wird die Geschichte von Protagonistin Kathy, die mit ihren 31 Jahren als Betreuerin arbeitet. Sie berichtet in Rückblenden von ihrem Leben: ihrer Kindheit und Jugend in dem wohlsituierten und angesehenem Halisham, in dem besonders viel Wert auf die Kollegialität und die Kreativität der Schüler gelegt wird, und ihrer Zeit danach als junge und freie Erwachsene, bis Kathy schließlich von ihrem beruflichen Werdegang und ihren Erfahrungen erzählt. Passend dazu ist der Roman in drei Abschnitte unterteilt.
Schon nach wenigen Seiten wird einem klar: Irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Obwohl man die Einzelheiten, wie zum Beispiel der sonderliche Umgang, die Andeutungen Kathys und die Unterhaltungen zwischen den Kollegiaten, ohne den Blick über das große Ganze nicht versteht, spürt man den grausig-schaurigen Unterton der Geschichte deutlich. Je weiter man in der Handlung voranschreitet, desto deutlicher wird, worum es in „Alles, was wir geben mussten“ tatsächlich geht. Dass Kazuo Ishiguro Themen behandelt, die man lange geahnt, aber nicht wahrhaben wollte. Und dennoch trifft es einen mitten in der Magengrube, wenn die Wahrheit im zweiten Teil des Romans endlich ausgesprochen wird.
Was Kazuo Ishiguros Geschichte so besonders, so speziell und vor allem einzigartig macht, ist die stille und harmlose Atmosphäre, die zwischen den Buchdeckeln extrem präsent ist. Sie steht im starken Kontrast zur Handlung und sorgt damit für ein Gänsehaut-Feeling, das es in sich hat. Vor allem Kathy will mit ihrer ruhigen Art nicht in die Geschichte passen – oder besser: Man möchte es als Leser selbst nicht, dass sie es tut. Sie sollte schreien, weinen, um sich schlagen! Stattdessen prügelt sie mit ihrer perfekt passenden Art, ihrem Realitätsbezug, der einem selbst beinahe verloren geht, den Lesern ein Gefühl unter die Haut, das einen noch lange beschäftigt. Kombiniert mit Ishiguros emotionslosem Schreibstil verschlägt einem „Alles, was wir geben mussten“ wahrlich die Sprache.
Fazit:
„Alles, was wir geben mussten“ ist eine Dystopie, die nicht einfach unterhalten, sondern zum Nachdenken bewegen, fordern, aufwühlen will. Kazuo Ishiguro hat einen bedrückenden und eindringlichen Roman geschrieben, der mich in jeglicher Hinsicht begeistert hat. Schon während des Lesens wollte ich über die Geschichte diskutieren, in sie abtauchen und schreien, die Charaktere an den Schultern rütteln! Doch Ishiguros eiskalter Schreibstil und seine einzigartige Art, eine schrecklich realistische Geschichte auf brutal ehrliche Weise zu erzählen, hat mich immer wieder erstarren lassen und mich sprachlos gemacht. „Alles, was wir geben mussten“ von Kazuo Ishiguro ist mehr als lesenswert. Eine Dystopie mit Anspruch, die genau deshalb nachdenklich stimmt, weil sie nicht völlig abwegig ist.