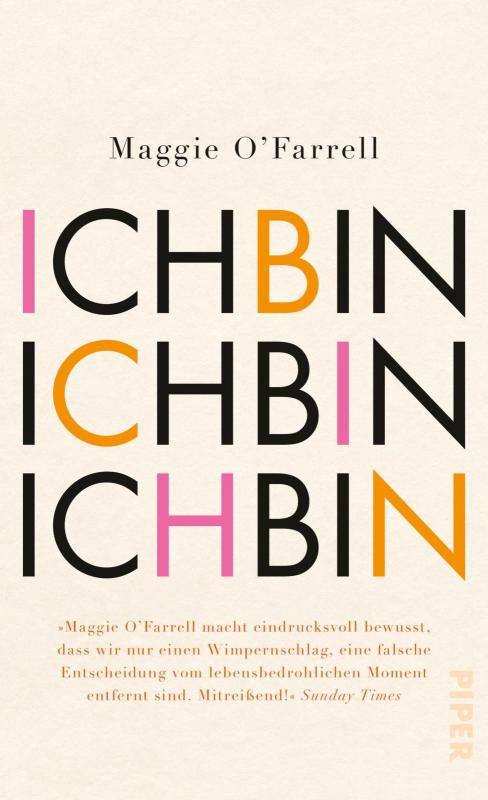Mit dem wunderbaren Portrait ihres Lebens zeigt Maggie O’Farrell ein ums andere Mal auf, was es bedeutet, dem Tod die Hand zu schütteln und trotzdem nach vorn zu sehen.
Maggie O’Farrells autobiographisches Buch „Ich bin, ich bin, ich bin“ hat mich bereits in der Verlagsvorschau angesprochen. Da ich ausgesprochen gerne über das Thema Todlese, war schon bald klar, dass ...
Maggie O’Farrells autobiographisches Buch „Ich bin, ich bin, ich bin“ hat mich bereits in der Verlagsvorschau angesprochen. Da ich ausgesprochen gerne über das Thema Todlese, war schon bald klar, dass ich dieses Buch verschlingen werde. Die Autorin erzählt in ihrem Werk von 17 Begegnungen mit dem Tod, die sich im Laufe ihres Lebens zugetragen haben. Fast vergewaltigt, fast ermordet, fast ertrunken, die Liste scheint sich endlos fortzusetzen. In den einzelnen Kapiteln erzählt sie von ihrem Leben, was sie zu der Zeit, als es passiert ist, bewegt hat, welche Reisen sie unternommen hat, lässt uns teilhaben an ihrem Leben, bevor sie beim Unvermeidbaren angelangt: dem jeweiligen Unfall, der prekären Situation, und wie sie den Kopf bei jeder dieser Gelegenheiten immer wieder aus der Schlinge gezogen hat. Wir erfahren, dass Maggie O’Farrell trotz einer schweren Erkrankung in ihrer Kindheit (die sie bis ganz zum Schluss aufspart) eine zielstrebige, mutige Persönlichkeit ist, die vor nichts zurückschreckt, aber als sie Mutter wird, alles tut, damit ihren Kindern keine ähnlichen Situationen widerfahren.
"Der Schmerz glich nichts, was ich bis dahin kannte oder seither kennengelernt habe. Er war randlos, er war vollkommen, wie ein Ei in seiner Schale vollkommen ist. Und er war raumgreifend, ein Usurpator; ich wusste, er wollte das Ruder übernehmen, mich aus mir verdrängen wie ein böser Geist, ein Dämon."
Maggie O’Farrell widmet jedes Kapitel einem anderen Körperteil (wobei einige auch mehrmals auftauchen), nämlich dem, der in diesem Abschnitt einer ernsten Gefahr ausgesetzt ist. Während einige Kapitel „gut zu lesen“ sind (wenn man das so sagen kann), stellen sich bei wieder anderen die Haare auf: als Maggie mit zarten 18 Jahren einen Waldspaziergang macht und auf dem Rückweg bemerkt, dass der Mann, den sie auf dem Hinweg bereits gesehen hat, wohl an einer nicht einsehbaren Stelle fernab des Dorfes, auf sie gewartet haben muss. Er legt ihr seine Fernglas-Schnur um den Hals, um ihr Vögel am See zu zeigen, sie windet sich mit einem lockeren Gespräch auf dem Weg ins Dorf zurück aus der Situation und erfährt später von der Polizei, dass dieser Mann bereits ein junges Mädchen mit der Schnur seines Fernglases ermordet hat. Fortan fragt sich O’Farrell, warum sie überleben durfte, während dieses Mädchen nicht so viel Glück hatte.
Während andere Memoiren oder Autobiographien oft langatmig sind oder einfach nicht spannend zu lesen sind (im Vergleich zu einem Roman), und ich deshalb auch Fiktion eigentlich bevorzuge, las sich „Ich bin, ich bin, ich bin“ einfach wunderbar. Aktuell habe ich noch nichts anderes von Maggie O’Farrell gelesen, bin aber ob des Schreibstils sehr versucht. Trotz des schwierigen Themas kommt in ihrem Werk niemals eine richtige Depression auf, was wohl an ihrem Schreibstil liegt. O’Farrell erscheint auch trotz ihrer vielen „Fast-Schicksalsschläge“ niemals hoffnungslos, sondern blickt zu jedem Zeitpunkt nach vorn und fährt mit der Devise, dass sie unendliches Glück gehabt hat, mit Vollgas fort, ihr Leben zu führen.
Die vollständige Rezension findet ihr auf dem Blog: https://killmonotony.de/rezension/maggie-ofarrell-ich-bin-ich-bin-ich-bin