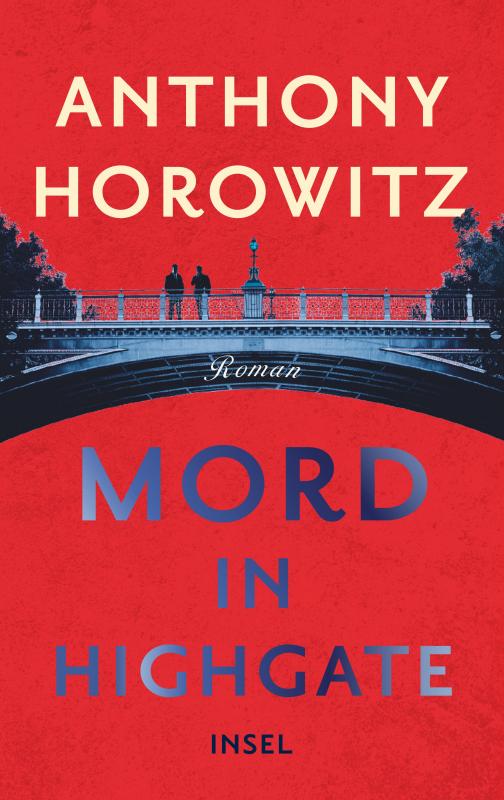Humorvoller Krimi in bester britischer Manier
REZENSION – Mit seinen eigenwilligen Krimis um den unsympathischen, aber als Privatdetektiv unschlagbaren Daniel Hawthorne hat der britische Schriftsteller Anthony Horowitz (64) eine Romanreihe geschaffen, ...
REZENSION – Mit seinen eigenwilligen Krimis um den unsympathischen, aber als Privatdetektiv unschlagbaren Daniel Hawthorne hat der britische Schriftsteller Anthony Horowitz (64) eine Romanreihe geschaffen, die mit ihrer geschickten Verbindung von Realität und Fiktion unvergleichlich ist. Nach „Ein perfider Plan“ (2019) fühlt man sich auch beim zweiten Band, „Mord in Highgate“, als Leser gedrängt, immer wieder im Internet zu prüfen, was oder wer nun echt oder nur erdacht ist.
Mitten in die Außenaufnahmen zur siebten Staffel der tatsächlich von Horowitz geschriebenen TV-Serie „Foyle's War“ platzt sein fiktiver Detektiv Hawthorne, um den Autor zur Aufklärung eines zweiten Mordfalles mitzunehmen. Horowitz hat eigentlich keine Lust, zumal er den oft überheblichen Hawthorne nicht leiden kann. Doch er hat – und dies ist Fakt – mit dem britischen Penguin-Verlag einen Vertrag über drei Bücher abgeschlossen, in denen er über die Arbeit seines Detektivs berichten soll.
Das Mordopfer ist der der Promi-Anwalt Richard Price, der in seinem Haus mit einer wertvollen Flasche Château Lafite Rothschild erschlagen wurde. Verdächtigt wird die feministische Schriftstellerin Akira Anno, die ihm wenige Tage zuvor in einem Restaurant ein Glas Rotwein ins Gesicht geschüttet und gedroht hatte, beim nächsten Mal eine ganze Flasche zu nehmen. Doch dann gibt es einen zweiten Toten. Beide Opfer verbindet ein Jahre zurückliegender Todesfall. Ist Rache das Motiv des Täters?
Der Reiz auch dieses zweiten Bandes um Daniel Hawthorne besteht in dem schnellen Wechsel von Fakten und Fiktion. Da ist Anthony Horowitz, in Deutschland vor allem durch seine verfilmte Jugendbuchreihe „Alex Rider“ bekannt, aber auch durch seine Sherlock-Holmes-Reihe, auf die in „Mord in Highgate“ häufig Bezug genommen wird. In diesem Krimi wird der Autor nun selbst zur Figur in einer fiktiven Handlung, in der er dem Privatermittler bei dessen Arbeit assistiert. Ähnlich wie bei Holmes und Watson bleibt dem berühmten Romancier aber zum eigenen Leidwesen nur die nachrangige Rolle des Protokollanten, der, ohne als Autor Einfluss nehmen zu können, ausnahmslos das Geschehen seinem fiktiven Protagonisten überlassen muss. Zwar versucht auch Horowitz, den Täter zu ermitteln, doch Hawthorne ist ihm und Scotland Yard immer einen Schritt voraus, weshalb der Autor eingesteht: „Das war mir jetzt peinlich. Ich war der Literat, ich hätte den Hintergrund dieser Geschichte erkennen sollen, nicht Hawthorne.“
Der Kriminalfall ist spannend, wenn auch dessen Auflösung geübte Leser britischer Krimi-Klassiker nicht überraschen mag. Wichtiger ist ohnehin die Rahmenhandlung: Da wechseln Fiktion und Realität in einem Tempo, dass beides kaum noch zu unterscheiden ist. Ganz verrückt wird es, wenn der fiktive Detektiv schließlich dem Autor empfiehlt: „Sie brauchen mich doch gar nicht. Sie können mich doch einfach erfinden.“ So wirkt es fast selbstverständlich, wenn Horowitz seine Danksagung beginnt: „Eine der Merkwürdigkeiten [….] besteht darin, dass ich am Ende Leuten zu danken habe, die selbst als Figuren im Buch auftreten.“ Und wieder wechseln dann reale mit fiktiven Personen. „Vielleicht war es ja doch keine so schlechte Idee“, meint der Autor im letzten Satz. Dem stimme ich zu: Die Romanreihe um Detektiv Daniel Hawthorne war eine gute Idee von Anthony Horowitz. Das eigenwillige Spiel in der engen Verbindung von Fakten und Fiktion ist ihm auch in „Mord in Highgate“ wieder ausgezeichnet gelungen, und der Krimi ist nach bester britischer Manier voller Ironie und Sarkasmus geschrieben. Wer sich gut unterhalten lassen will und auch bei Krimis gern schmunzelt, wird sicher seine Freude haben.