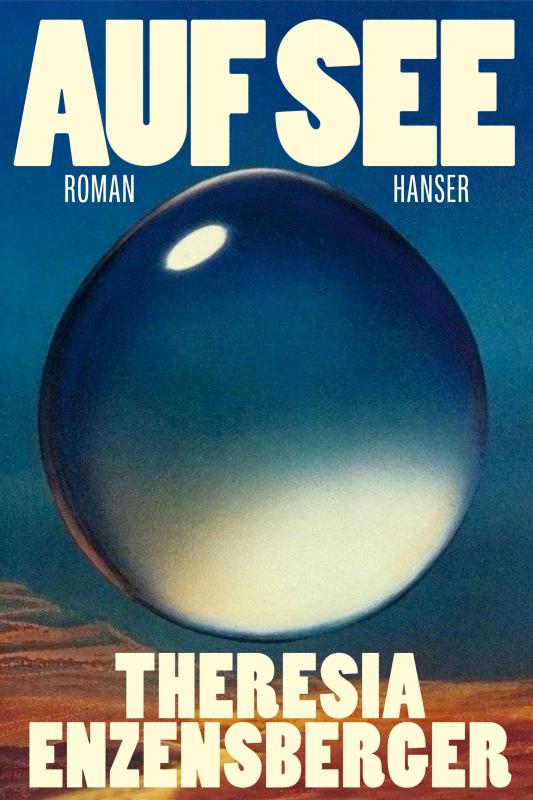Niemand ist eine Insel
Theresia Enzensbergers „Auf See“ ist eines dieser Bücher, das unter einem Text leidet, der mutmaßlich nicht von der Autorin stammt – nämlich dem Klappentext. Versprochen wird eine Geschichte „von der Freiheit ...
Theresia Enzensbergers „Auf See“ ist eines dieser Bücher, das unter einem Text leidet, der mutmaßlich nicht von der Autorin stammt – nämlich dem Klappentext. Versprochen wird eine Geschichte „von der Freiheit des Einzelnen und dem utopischen Versprechen neuer Gemeinschaften im Angesicht des Untergangs“, ein Chaos, „in dem die übrige Welt versinkt“, denn: „Die Welt geht unter“. Zu erwarten ist eine Dystopie. Wer Freude an dieser literarischen Gattung hat (ich zum Beispiel), der freut sich darauf, wie die Missstände unserer Gegenwart in die Zukunft verlängert, radikalisiert ausgeführt werden und die Welt, wie wir sie kennen, sich im oben genannten Sinn untergeht. Der Einzelne sieht sich dann in der dystopischen Zukunft mit dem Dilemma der Gegenwart konfrontiert, während die geneigte Leserschaft etwas über den Menschen und über die Gegenwart lernt.
Man kriegt aber nur so eine Art dystopischer Kulisse, in der es an globalisiertem Obsthandel (frische Kiwis), funktionierenden Bankautomaten und einem florierenden Kunsthandel keinen Mangel gibt. Gut – der Berliner Tiergarten wird von einer Zeltstadt obdachlos gewordener Angestellten des unteren Lohnsegments bevölkert, aber die Lösung dieses Problems scheint im Mittel der Vergangenheit zu liegen: Räumungsbescheid des Bezirksamtes. Das hatten wir schon auf dem Oranienplatz.
Während die Dystopie nicht ausgeführt wird, schade, erfahren wir wenigstens etwas über den systemischen Knacks von Utopien, beispielsweise den der Freistatt in der Ostsee, auf der die Protagonistin Yada aufwächst und die ihr Vater einst idealistisch begonnen hat und die jetzt die „utopischen versprechen“ (s.o.) keinesfalls mehr erfüllt. Das ist nett, aber in „Die Welle“ u.a. schon deutlich besser gezeigt worden.
Was bleibt?
Der Roman erzählt in zwei Ebenen: Yadas Geschichte ist eine Coming-of-Age-Story mit viel Potenzial. Ihr Aufbruch aus dem Korsett ihrer Jugend, der Isolation auf der Freistatt und ihre Emanzipation gegenüber ihrem Vater sind gelungen und unmittelbar ansprechend für alle, die Coming-of-Age-Storys mögen (ich zum Beispiel). Die zweite Eben ist Helenas Geschichte. Sie ist eine unabhängige Künstlerin, die sich von der Gesellschaft und den Massenmechanismen abzuwenden versucht. Helenas Satire auf das Sektenunwesen schlägt ins Gegenteil um: Statt den Menschen die Augen zu öffnen, gründet sie aus Versehen eine Sekte und ist danach bemüht, sich zu isolieren und dem Wirbel um sie als „Orakel“ und Youtube-Star zu entgehen.
Die Montagetechnik ist klar: Yada kommt von einer Insel, Helena will eine Insel sein - und beide Inseln scheitern am Menschen. Oder um es mit John Donne zu sagen, der im 17. Jahrhundert gelegt hat: „Niemand ist eine Insel, in sich ganz; jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes.“
Die beiden gegeneinander montierten Erzählebenen begegnen einander in der Mitte, und nicht zufällig ist es die Seite in der Mitte, in der ein Handlungsknoten platzt (S. 129 von 259). Zwischen Yada und Helena als Ich-Erzählerin bzw. Point-of-View-Charakter (das Prinzip wird im zweiten Teil aufgebrochen, weil aus Sicht weiterer Figuren erzählt wird, leider) ist das „Archiv“ zwischengeschaltet. Ihn diesen Kurzkapiteln referiert Enzensberger gescheiterte Utopien und Inselprojekte – diese Essays sind in meinen Augen der stärkste Teil des Buchs. Die Erzählweise Enzensbergers ist knapp, prosaisch und fast schon dürr – keinesfalls ansprechend.
Fazit: Hätte es diesen Klappentext nicht gegeben, man könnte den Roman viel mehr als Geschichte genießen und nicht auf die Gesellschaftskritik hoffen, die innerhalb des Romans die Behauptungssphäre kaum verlässt. Nicht zu Unrecht empfiehlt die Rezension in der ZEIT den Roman jugendlichen Lesern – diese werden auch aus den Archiv-Essays besonders viel Honig saugen können.