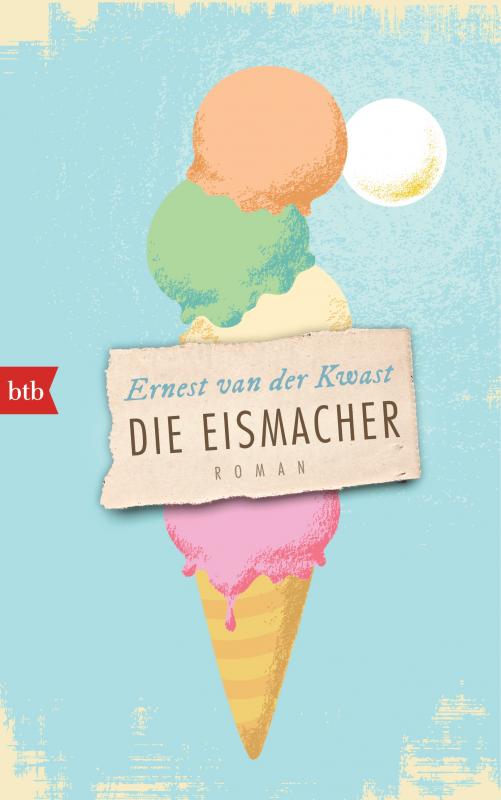„Wir wollen so viel an die nächste Generation weitergeben. Eis, Poesie, Werkzeug. Eine bestimmte Lebensweise. Nichts will man verloren gehen lassen, weil man sich sonst selbst infrage stellen müsste.“ S. 349
Ernest van der Kwast schreibt vom Leben der Familie Talamini, aus dem Tal der Eismacher in der Region Venetien, Provinz Belluno, nord-westlich von Venedig. Er erzählt aus der Sicht des Ich-Erzählers Guiseppe über die Gegenwart der Familie, mit Rückblicken auf die Familiengeschichte ab dem Urgroßvater des Ich-Erzählers, der ebenfalls Guiseppe hieß. Dieser war der erste Talamini, der Speiseeis hergestellt hat. Mühselig musste er die Maschine dafür mit der Hand drehen („drehen, drehen, drehen“ ist eines der oft wiederholten Motive); das Eis zum Herunterkühlen der Zutaten hatte er selbst aus den Bergen geholt. Er war zuerst als Maronibräter nach Wien gegangen, bevor er seiner Faszination für die Eisherstellung nachgeben konnte. Seine Nachkommen folgen der Familientradition: der Vater des Ich-Erzählers, Beppi (natürlich auch ein Guiseppe), sah mit seinen zwei Söhnen die Nachfolge als gesichert an. Als Kinder sind die Brüder noch unzertrennlich, selbst, als sie sich beide in Sophia verlieben: „Luca und ich spielten beide eine absurde Variante des alten Ich-bin-nicht-verliebt-Spiels, und irgendwann konnte ein Dritter mit unserer Beute das Weite suchen. Doch dazu kam es nicht, es trat nie ein Dritter in Erscheinung.“ S. 134
Stammhalter Guiseppe entscheidet sich gegen die Familientradition: er liebt die Poesie, studiert, arbeitet im Verlag, für eine Lyrikzeitung, für Lyrikfestivals. So übernimmt der jüngere Sohn Luca das Familiengeschäft. „Er [der Bruder, Luca] arbeitete sechzehn Stunden am Tag, machte Eis, verkaufte Eis, reinigte die Maschinen und fiel am späten Abend wie ein Klotz ins Bett. Seine Welt war das Eiscafé, meine begann dort, wo die Terrasse aufhörte.“ S. 180 Es ist hart, das Leben der Eismacher, mit langen Arbeitstagen in der Fremde, Wochen ohne Wochenende oder Freizeit, auch ohne die Kinder, die der Schule wegen in Italien bleiben, im Internat oder bei Verwandten. In den Sommerferien besuchen die Kinder ihre Eltern dort, wo die ihre Cafés betreiben, in Rotterdam, wie im Buch, oder in Deutschland, Österreich oder sonst in Europa.
Der Autor beschreibt viele Welten in seinem Buch: er berichtet von Lyrik-Liebhaber Guiseppe, der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Hotels in der ganzen Welt kennt, aber sich sonst oft als Fremder fühlt, weil er soviel unterwegs ist; er erzählt die Geschichte der Eisherstellung, vom harten Leben in Norditalien gegen Ende des 18. Jahrhunderts; er redet vom Bruch in der Familie. Das Buch spricht von Liebe und Verzicht, vom Umsetzen von Träumen und von Pflicht, von Tradition und Moderne, von Hoffnungen und davon, dass nicht alles gut werden muss, wenn diese sich erfüllen. Es spricht aber auch viel davon, was ist, wenn Wünsche nicht erfüllt werden: „Ich sah, weshalb mein Bruder aus Olivenöl Eis zu machen versuchte, warum er Melone mit Minze mischte, warum er bis tief in die Nacht über Rezepten brütete. Ich sah, warum Sophia manchmal bis halb elf im Bett blieb und den ganzen Tag auf die Pfützen starrte, in denen kleine Kinder mit ihren Stiefeln herumplantschten.“ S. 220
Ich bin kein Poesie-Liebhaber (das Buch schreibt lange und viel über und von Poesie wie vom Eismachen), aber ich verstehe Faszination. Ich verstehe Genuss. Im Buch sagt der Vater über Sohn Luca: „Sein Vanilleeis ist so fest und unwiderstehlich wie der Hintern von Sophia Loren.“ Dazu antwortet sein Gast, jemand aus der Lyrik-Welt von Sohn Giovanni: „Jetzt weiß ich, von wem ihr Sohn seine Liebe zur Poesie hat.“ S. 190. Beides ist sinnlich, Kunst und Genuss – allerdings sieht das speziell der Vater nicht, sieht es Bruder Luca nicht – sieht es vielleicht nicht einmal Sohn Giovanni.
Während ich im ersten Teil des Buches nur vom Erzählstil gefangen war und davon, in mehrere mir fremde Welten völlig einzutauchen, ließ mich der zweite Teil vieles überdenken. Wenn ich für die Selbstverwirklichung bin, kann das auch das Ende von Traditionen bedeuten, den Verlust von Kulturgut: viele Handwerker finden heute keine Nachfolger mehr. Wenn ich mich der Pflicht verschreibe, bin ich hingegen vielleicht irgendwann verbittert und hasse die, die sich freier entschieden oder um derentwillen ich diese Pflicht auf mich nehme. „Wir wollen so viel an die nächste Generation weitergeben. Eis, Poesie, Werkzeug. Eine bestimmte Lebensweise. Nichts will man verloren gehen lassen, weil man sich sonst selbst infrage stellen müsste.“ S. 349 Ein starkes Buch, das sich einfachen Lösungen verwehrt und lange nachhallt.