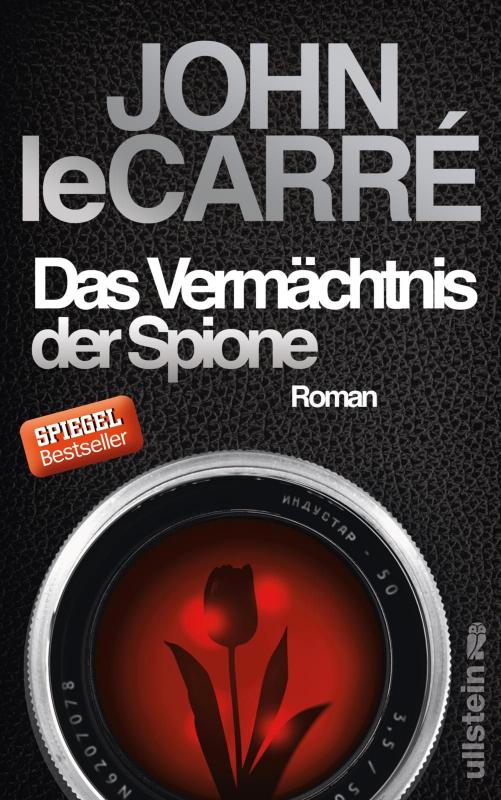Schwieriges Erbe
Schon im ersten Satz wird John le Carrés Roman seinem Titel gerecht, denn der Ich-Erzähler erklärt, seine Geschichte nach bestem Wissen und Gewissen verfasst zu haben. Das erinnert vom Ton her an eine ...
Schon im ersten Satz wird John le Carrés Roman seinem Titel gerecht, denn der Ich-Erzähler erklärt, seine Geschichte nach bestem Wissen und Gewissen verfasst zu haben. Das erinnert vom Ton her an eine Testamentseröffnung, inhaltlich an eine Zeugenaussage vor Gericht. Eigentlich nimmt die Eröffnung der Geschichte den Ausgang der Handlung schon vorweg, doch wird dadurch, dass der Ich-Erzähler für seine Geschichte weit ausholt, deutlich, dass es vorrangig um die Ereignisse geht, die zu diesem Ausgang führen.
Der Eindruck der Zeugenaussage verstärkt sich im Laufe, denn der Erzähler rechtfertigt sich sich zwischendurch immer wieder oder erklärt bestimmte Beweggründe. Dabei wird nicht direkt ersichtlich, wem diese Rechtfertigungen gelten. Dem Leser? Einem Richter? Einem unbekannten Zuhörer? Vielmehr scheint der Erzähler sich vor sich selbst rechtfertigen zu müssen. Wozu es auch passt, dass er nicht nur die direkten Ereignisse wiedergibt, sondern eine detaillierte Vorgeschichte dazu erzählt.
Ich-Erzähler Peter Guilliam, der ehemalige Assistent von le Carrés Held George Smiley führt den Leser dabei zurück in das Jahr 1961. Das Jahr, in dem die Berliner Mauer gebaut wurde und in dem der britische Agent Alec Leamas zusammen mit seiner Freundin dort ums Leben kam. Zunächst deutet alles daraufhin, dass Leamas zu Unrecht gestorben ist, doch wie so oft in Romanen, in denen es um den Geheimdienst geht, ist die Erkenntnislage nicht so einfach.
Und noch bevor der eigentliche Held George Smiley überhaupt auftaucht, ist der Leser gefangen von der Faszination und der Gefahr, die von der Geheimdienstarbeit ausgeht. Ein weiteres zentrales Element ist die Aufarbeitung der Vergangenheit. Hierbei steht die Frage im Raum, ob damals begangene bzw. ausgeführte Handlungen heutzutage neu bewertet werden müssen, wenn man neue Erkenntnisse dazu gewinnt. Die Diskussion dieser Frage begleitet den Leser ebenfalls durch den Roman und trägt auch dazu bei, dass man gebannt Seite für Seite weiterliest.
John le Carré versteht es meisterhaft, seine Geschichten vermeintlich harmlos zu beginnen. So auch “Das Vermächtnis der Spione”. Ähnlich wie die Protagonisten, die ebenfalls noch nicht wissen, was sie im Laufe der Handlung erwartet, tastet sich auch der Leser Stück für Stück voran und findet sich unversehens mitten im Geschehen wieder. Zu spät, um sich dem Sog der Handlung zu entziehen.