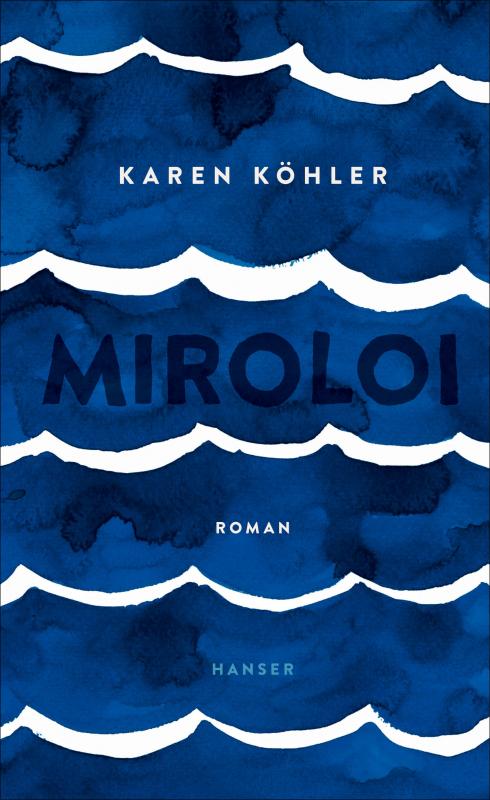Überschätzt
Ihr Miroloi, also die persönliche Totenklage, wird die zunächst namenlose Heldin des Romans sich selbst singen müssen. Auf ihrer Heimatinsel ist sie eine Ausgestoßene. Von den Eltern ausgesetzt und vom ...
Ihr Miroloi, also die persönliche Totenklage, wird die zunächst namenlose Heldin des Romans sich selbst singen müssen. Auf ihrer Heimatinsel ist sie eine Ausgestoßene. Von den Eltern ausgesetzt und vom Bethaus-Vater, dem Priester des Dorfes aufgezogen, ist sie nicht Teil der Gemeinschaft, darf keinen Namen tragen, nicht heiraten, sich nicht fortpflanzen. Schon die Dorfkinder quälen sie zum Spaß, die Frauen des Dorfes verachten sie, während die Männer des Dorfes noch Schlimmeres tun. Wie der Dorflehrer, der junge Mädchen nach der Schule zu sich bestellt oder die Ältesten (natürlich auch alle Männer), die mit ihren Gesetzen die Frauen kleinhalten und unterjochen. Doch eines Tages lernt unsere junge Protagonistin den Betschüler Yael kennen und verliebt sich. Er wird ihr endlich einen eigenen Namen (Alina) und Mut für die Zukunft geben. Und auch innerhalb der Gemeinschaft beginnen die Dorffrauen, einige Dinge in Frage zu stellen.
"Miroloi" und sein Platz auf der Longlist des Deutschen Buchpreises wurde in den vergangenen Wochen kontrovers diskutiert und ich muss zugeben, dass auch ich mich den Lobeshymnen über dieses Buch nicht anschließen kann. Zu vieles im Roman passt nicht zueinander, wirkt versatzstückhaft zusammengesetzt. Das beginnt schon mit der Verortung der Geschichte. Von Olivenbäumen ist die Rede, von Granatäpfeln, von Eseln als Fortbewegungsmittel - Griechenland also, so schließt der Leser. Zunächst wird das auch durch die Namensgebung unterstützt: Yannis, Mariah, Panagiota - doch dann taucht er auf, Jakup Jakupsohn und man fragt sich: Wie passt der Skandinavier in diese Welt? Nun ja, irgendwann wird die Autorin es schon erklären, so denkt man, doch die bleibt diese Antwort schuldig - und dies ist nur eines von vielen losen Enden, die nicht mehr aufgegriffen werden.
Die Begrifflichkeiten sind ebenso verwirrend, es ist von Domates die Rede anstatt von Tomaten, von Patates und Melitzanes, aber dann wieder von Schafskäse und Honig. So als wollte die Autorin ein wenig Sprachkolorit ausstreuen, bis ihr die griechischen Vokabeln ausgingen. Ähnlich wird im Roman mit Religion verfahren: die Dörfler verehren eine göttliche Dreifaltigkeit, die Welt als Gesamtes ist ursprünglich aus dem Ei geschlüpft. Man feiert die keltische Sommersonnenwende, wendet mit der "satva" Rituale aus dem indischen Kulturraum an und die Toten werden von drei Fährfrauen(!) und mit Münzen auf den Augen in die Unterwelt geleitet. Ach ja, und am Ende müssen sich die Dorffrauen übrigens noch verschleiern. Man sieht also, sehr viele Anleihen an andere Religionen und Kulturen und sehr wenig eigenes von Frau Köhler. Schade, hier hätte ich mir ein eigenes erdachtes System oder den konsequenten Verbleib bei einer Religion/Kultur gewünscht.
Auch sprachlich ist der Roman eine Herausforderung. Der Protagonistin fehlt die elterliche Liebe und Prägung. Lange Zeit darf sie auch nicht lesen oder schreiben, bis der Bethaus-Vater doch den Mut findet, es ihr heimlich beizubringen. Dementsprechend begrenzt und kindlich-naiv ist ihre Sprache; eine Tatsache, die von einigen Kritikern frenetisch gefeiert wird. Jedoch ist diese Sprache nicht nur bisweilen sehr befremdlich, so zum Beispiel, wenn unsere Heldin vor Liebe zu ihrem Betschüler "stinken möchte wie ein Käse", sondern vor allem dann, wenn die gesamte Weltklugheit und Poesie aus ihr hervorzubrechen scheint. Da tauchen auf einmal Metaphern aus Fotografie und Film aus - beides ist übrigens von der Insel verbannt, denn die Ältesten lehnen jegliche Art von Fortschritt ab. Woher hat das Mädchen also seine Vokabeln? Sie entwickelt sich eben weiter, sagen die Fans. Unglaubwürdig und gewollt poetisch, sage ich.
Und noch eine Sache stört mich an dem Roman. Feministisch soll er sein, weil die Heldin sich gegen die patriarchalischen Strukturen auflehnt. Das mag ja im Grunde richtig sein, dennoch stellt sich für mich eine wichtige Frage: Der Wunsch nach einem Namen und damit der Möglichkeit, sich zu anderen in ein Verhältnis zu setzen, das ist der charakterliche Kern der Protagonistin. Und woher erhält sie diesen Namen? Natürlich von einem Mann, mit dem sie Sexualität teilt, denn Liebe kann man das beim besten Willen nicht nennen. Wie kann das also ein feministischer Akt sein, wenn ein Mann nötig ist, um einer Frau Identität zu geben? Natürlich ist es im Verlauf der Handlung schön zu erleben, wie die Frauen des Dorfes sich nach und nach auflehnen, wie sie sich nach Strom und Haushaltsgeräten sehnen, die ihre Zukunft verbessern sollen. Doch leider verläuft so vieles im Sand oder wird beim kleinsten Widerstand aufgegeben. Natürlich ist es schwer, eingefahrene Strukturen zu durchbrechen, aber anstatt der angeblich so feministischen Ausrichtung zeigt "Miroloi" eigentlich nur, dass es nahezu unmöglich ist, etwas zu verändern. Am Ende wird ausgerechnet ein Mann zum "Zünglein an der Waage", was die Handlung betrifft - schade, aus diesem Thema hätte man so viel mehr machen können.