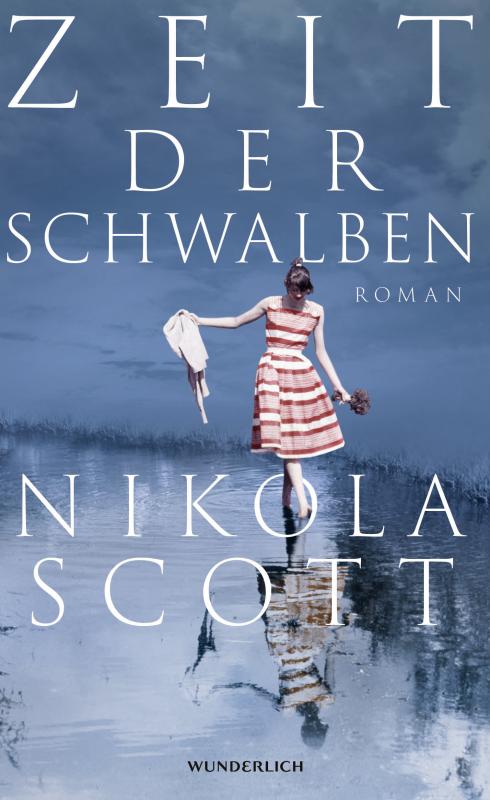ohne Kitsch auf Spurensuche nach der Mutter
Am Anfang steht der große Verlust der Mutter. Sie stirbt bei ihrem Unfall und ihre erwachsene, älteste Tochter Addie bleibt zerrissen zurück. Nie hat sie es Elisabeth recht machen können. Der Vater zieht ...
Am Anfang steht der große Verlust der Mutter. Sie stirbt bei ihrem Unfall und ihre erwachsene, älteste Tochter Addie bleibt zerrissen zurück. Nie hat sie es Elisabeth recht machen können. Der Vater zieht sich in eine ausgewachsene Depression zurück, die jüngere Schwester versucht mit aller Macht, Kontrolle zumindest vorzuspielen und ihr bester Freund will unbedingt ein Restaurant mit Addie eröffnen. Genug für eine Krise. Doch alles gerät aus den Fugen, als eine Frau vor der Tür steht, und behauptet, Elisabeths Tochter zu sein, am gleichen Tag geboren, wie auch Addie selbst.
Es ist mehr als nur eine individuelle Apokalypse, die der Roman erzählt. Der Umsturz einer Familie, in all ihren Strukturen und vor allem ihrem größten Geheimnis. Im Zentrum aber steht Addie und ihre ganz eigene Art und Weise, die Dinge zu betrachten. Der Verlust der Murrer, gefolgt vom Verlust dessen, was sie immer über Elisabeth zu wissen geglaubt hat. Es ist eine Identitätskrise, die mitschwingt. Nicht nur für Addie, sondern auch für ihre Fremdsicht auf Elisabeth. Wie prägend dieser Eindruck der eigenen Mutter ist, wird im Laufe des Romans und vor allem am Ende immer wieder klar. Addies Entscheidungen sprechen für sich.
In Zeit der Schwalben erfolgt die Spurensuche über Bruchteile. Der Leser aber erfährt die volle und wahre Geschichte, indem immer wieder Zeitsprünge zurück zu Elisabeths Tagebucheinträgen führen. Zwei Erzählstimmen also, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Denn die Elisabeth der Tagebücher ist gerade mal 16, steht vor dem größten Verlust, und das im Grunde gleich zweimal. Dahinter verbirgt sich ein schonungsloser Blick auf den Umgang mit jungen, unverheirateten Schwangeren im England der fünfziger Jahre, auf Abläufe in Heimen für ledige Mütter und Krankenhäuser, aber auch ein Blick in die Moralvorstellungen jener Zeit. Es sind die Folgen dieser Verstrickungen, die Addie aus der Bahn werfen.
Wenig märchenhaft ist dafür ihr Roman. Addie ist keine verkitschte, aufgeregte Frauenfigur, sondern sehr nachdenklich und introvertiert. Oft sagt sie lieber gar nichts, selbst wenn ihr etwas auf der Seele brennt. Sie sucht die Schuld immer bei sich und wird nun von einer ganz anderen Art von „Schuld“ konfrontiert. Dass sie nicht weggegeben wurde. Zeit der Schwalben versucht auch da trotz Ich-Erzählerin mehrere Perspektiven anzubieten und schafft das souverän. Komplex durchdacht und mit Feinheiten zurechtgeformt. Es waren sehr wenige Stellen, die mich irritiert haben oder zum Meckern veranlassen. Am meisten die Liebesgeschichte, die irgendwie zwischendrin geradezu aufgedrängt wird. Sie hätte für mich gerne fehlen kommen, denn das Ende des Romans ist eigentlich Addies Abschluss mit der Geschichte ihrer Mutter – und dafür braucht es keinen Mann.