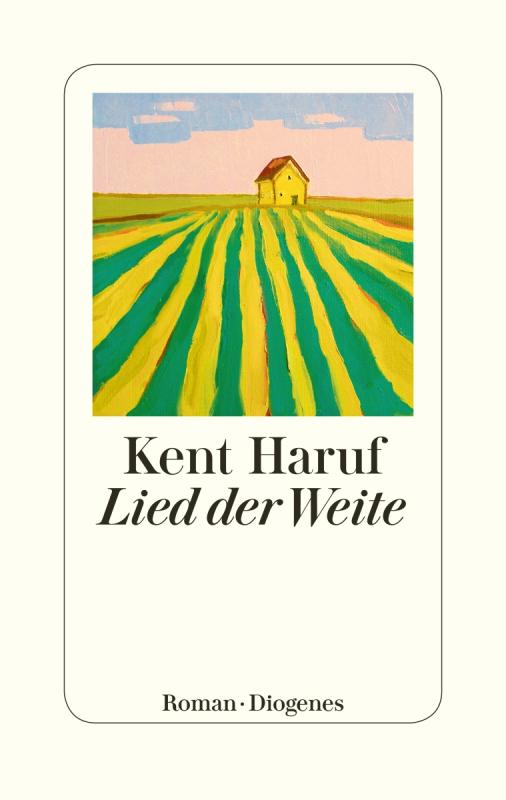„Das Mädchen sah müde und traurig aus, sie hatte die Decke um die Schultern gewickelt wie jemand, der ein Zugunglück oder eine Überschwemmung überlebt hat, trauriges Überbleibsel einer Katastrophe, die ihren Schaden angerichtet hat und weitergezogen ist.“ (S. 37)
Kent Harufs „Lied der Weite“ verspricht eine unterhaltsame Geschichte vor dem Hintergrund einer amerikanischen Kleinstadt, in der das Schicksal eines Mädchens das Leben anderer Stadtbewohner auf den Kopf stellt.
„Ihre Augen hatten immer noch eine wunde Direktheit, als wären Trauer und Zorn nur knapp unter die Oberfläche gesunken.“ (S. 104)
Auf den ersten Seiten dieses Romans konnten mich Sprache, Figuren und vor allem die Stimmung des Textes ziemlich nachhaltig fesseln, deswegen wollte ich es auch unbedingt lesen. Die vorgestellten Personenkonstellationen und Hintergründe versprachen einen spannenden Verlauf mit vielen potentiellen Reibungspunkten, auf den ich mich echt gefreut habe; rückblickend hätte ich zumindest die ein oder andere Anstrengung voraussehen können. Insbesondere die fehlenden Anführungszeichen in der wörtlichen Rede machten mir das Lesen schwerer als gedacht, und auch die abgehackten Sätze, die zu Beginn reizvoll erschienen, begannen irgendwann zu nerven: „Seit acht Tagen war die Schule aus. Aber das Freibad war noch nicht geöffnet. Die Baseball-Sommersaison hatte noch nicht angefangen. Und auch auf dem Rummelplatz würde es erst in der ersten Augustwoche losgehen.“ (S. 253)
Zu all dem kam, dass mir nicht klar war, worauf der Autor hinauswollte. Das kann natürlich genauso gut auch an mir gelegen haben, sodass diese Feststellung allein mich nicht dazu bringen würde, vom Lesen dieses Romans abzuraten, doch eine Erwähnung ist es mir wohl wert. Auch bei dem Satz „In der Spüle stand kein Geschirr, der Tisch war geschrubbt, auf den Stühlen war nichts mehr von den Lappen und Maschinenteilen zu sehen, und der Boden wirkte so sauber gefegt, als hätte eine Immigrantin den Besen geschwungen.“ (S. 114) musste ich doch sehr schlucken und gleichzeitig überlegen, was damit gemeint sein könnte.
Zuletzt hatte ich den Eindruck, dass es Haruf zu viel Aufwand war, den Brüdern unter seinen Figuren eigenständige Charaktere zu verleihen: Besonders die beiden Jungen hatten kaum eine eigene Persönlichkeit und Absätze wie „Oben im Bad kämmten sie sich mit nassem Kamm, zogen ihr Haar zu Wellen hoch und lockerten es mit den hohlen Händen auf, bis es über der Stirn steil nach oben stand. Wasser tröpfelte ihnen auf die Wangen und hinter die Ohren. Sie trockneten sich ab gingen auf den Flur hinaus und blieben zögernd vor der Tür stehen[…]“ (S. 19) sorgten in meinem Kopf für zugegebener Maßen amüsante Episoden von sich synchron bewegenden Kindern.
Insgesamt fehlt mir leider das, was im Klappentext versprochen wird: Dass das Schicksal des Mädchens, dass die gute Tat der Brüder, die sie aufnehmen, „das Leben von sieben Menschen in der Kleinstadt Holt in Colorado umkrempelt und verwandelt“ (Zitat Klappentext). Ja, wir können in sehr gemächlichem Tempo einer gewissen Entwicklung folgen, wir kommen den Bewohnern dieser Kleinstadt auch sehr nahe, doch leider hatte ich nie das Gefühl, dass wirklich etwas passierte.